Vermutlich hat sich aus dem Begriff Docke
das Wort doll (für Puppe) abgeleitet, möglicherweise
im Zusammenhang mit Volksfesten, auf denen Budenbesitzer für den
Kauf „hübscher Docken“ geworben haben.
Der Begriff doll wird im Englischen auch als Bezeichnung für
ein hübsches Mädchen verwendet. Offensichtlich steht der Spielgegenstand
„Puppe“ in einem engen Verhältnis zum weiblichen Geschlecht.
Nimmt man den gesamten Bereich des Spielgegenstandes „Puppe“
in Blick, so kann man in Hinblick auf die Erscheinungsformen fünf
Bereiche unterscheiden: Spielpuppen, Modepuppen, Puppenfiguren, Theaterpuppen
und selbsttätige Puppen.

Die Spielpuppe tritt uns quasi als Einzelwesen gegenüber. In der Hand des Kindes wird diese Puppe zu einem persönlichen Gegenüber, in dem sich das Kind spiegeln kann. Mit Hilfe der Puppe kann das Kind sich selbst und seine Erlebnisweisen erkunden. Im Spiel mit der Puppe erfährt das Kind etwas von sich und kann spielerisch Formen der Beziehung zur Umwelt (zu Eltern und Geschwistern) erproben. Daher ist die Materialbeschaffenheit (Holz, Porzellan, Ton, Stoff usw.) von eher nachrangiger Bedeutung. (vgl. Fritz, S.64)
Ursprünge und Nutzungsbereiche der Puppe
Warum wendet sich das Kind in spielerischer Absicht der Puppe zu?
Ursprünge und Nutzungsbereiche der Puppe
Der Ursprung der Puppe liegt im Dunkeln der Geschichte.
Die Puppe als Ebenbild und „Stellvertreter“ des Menschen stellt
einen der ersten Versuche der Menschheit dar, sich selbst zu objektivieren,
sich ihrer selbst bewusst zu werden, nach außen deutlich zu machen,
wie sie sich selbst sieht.
Man kann davon ausgehen, dass einfachste Puppen für das Spiel der
Kinder bereits in frühester Zeit Verwendung fanden und dass es einen
fließenden Übergang der Puppe von ihrer Funktion in rituellen
Praktiken zum Spiel des Kindes gegeben hat. Darauf deuten nicht nur Indianerbräuche,
sondern auch verbürgte Berichte aus der Geschichte europäischer
Völker. Die aus geplünderten Kirchen entwendeten Madonnenfiguren
wurden nicht selten Kindern zum Spielen gegeben.
Im Spiel mit der Puppe geht Gesellschaftliches mit ein: sowohl die Produktionsmittel
einer Gesellschaft als auch die tragenden Normen, Herrschaftsverhältnisse,
Rollenverteilungen, Frauenideale und Wertvorstellungen. Das Kind „fädelt“
sich in die gesellschaftliche Umwelt ein, indem es das nachahmt, was es
sieht, und damit es das vorahmt, was ihm vorbestimmt zu sein scheint.
Insofern mag die Puppe prägend sein für das Verhalten des Kindes
zu den Menschen, zu seinen Rollenvorstellungen und Verhaltensmustern.
So spiegelt sich die gesellschaftliche Wirklichkeit im Kinderspiel mit
der Puppe wider: „Bei dem einen Mädchen backt, näht, wäscht
und plättet die Puppe, beim anderen thront sie auf dem Sofa, empfängt
Besuche, eilt ins Theater und zur Gesellschaft, beim dritten schlägt
sie Leute, legt eine Sparbüchse an und zählt das Geld. Wir trafen
Kinder, bei denen bereits die Lebkuchenmännchen Rangbezeichnungen
trugen und Bestechungsgelder annahmen.“
Der Kern dessen, was wir unter „Puppen“ verstehen
sind die als „Einzelwesen“ auftretenden Spielgegenstände.
Diese Puppen, Gegenüber und Projektionsfläche des Menschen,
werden in der Hand des spielenden Kindes zu einem Medium, sich selbst
zu erkennen, zu entfalten und in die Gesellschaft hineinzuwachsen. Insofern
spiegeln diese Puppen nicht nur das spielende Kind wider, sondern auch
die Gesellschaft mit dem Stand ihrer technologischen Entwicklung, den
Normen, den gesellschaftlichen Schichten und nicht zuletzt den geschlechtsspezifischen
Handlungsmustern.
Man kann davon ausgehen, dass es die Spielpuppe für das Kind seit
dem Beginn der kulturellen Entwicklung der Menschheit gegeben hat: parallel
zu rituellen Praktiken, in der Regel von Kindern und Eltern aus einfachen
Materialien und ohne größeren Aufwand selbst gefertigt. Die
ältesten überlieferten Puppen aus handwerklicher Herstellung
stammen aus Ägypten (um 2000 v. Chr.). „Sie sind aus dünnen
Brettchen geschnitten, ihr Körper ist mit geometrischen Mustern bemalt,
die das Gewand andeuten sollen, auf dem Kopf sitzt mit Erdpech angeklebt
eine Perücke aus Haarsträhnen von aufgefädelten Holz- oder
Lehmperlen. Arme und Beine sind häufig beweglich. (vgl.
Fritz, S. 66-71)
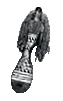
 Hier
sieht man zwei ruderförmige ägyptische Puppen um 2000 v.Chr.
Hier
sieht man zwei ruderförmige ägyptische Puppen um 2000 v.Chr.
Warum wendet sich das Kind in spielerischer Absicht der Puppe zu?
Die Puppe ist für das Kind faszinierend, weil sie
ein Abbild des Menschen darstellt: sowohl der eigenen Person als auch
wichtiger Personen aus der Umwelt.
Für das ältere Kind wird die Puppe zu einem Objekt, mit dessen
Hilfe sich das Spiel entfalte ausdifferenziert und das es ermöglicht,
die notwendige Distanz zwischen sich, der Mutter und der übrigen
Umwelt in einer für das Kind akzeptablen Weise zu schaffen. Das Kind
erlebt anfangs eine sehr enge Beziehung zur Puppe. Die Puppe wird quasi
Teil seines Körpers und verhilft dem Kind, die kurze Abwesenheit
der Mutter zu ertragen, kann das Kind doch über seine Puppe verfügen,
nicht jedoch über die Mutter. Die Puppe als Abbild des menschlichen
Gegenübers kann im Spiel des Kindes ein Objekt sein, mit dessen Hilfe
Kinder lernen können, ihre Gefühle und Beziehungsmuster auszudifferenzieren
und alltägliche Erfahrungen zu verarbeiten.
„Die Puppe kann ausgeschimpft, geschlagen werden. Mit ihr kann das
Kind das tun, was es selbst von den Eltern erfährt – seien
es gute oder schlechte Erfahrungen. Diese Rollenumkehr, bei der die Puppe
die Rolle des Kindes übernimmt, ist eine wichtige Möglichkeit
der Verarbeitung und gleichzeitig der Identifizierung mit den Eltern und
Erzieherinnen. Auch Aggressionen, Eifersucht und Wut gegenüber den
Geschwistern und gleichaltrigen Freunden lassen sich gefahrloser mit deren
Puppen-Stellvertretern austragen als mit diesen selbst.“
Die Puppe wird zu einem Anreiz, sich mit der Realität zu beschäftigen,
sie im Spiel nachschaffend zu verstehen und sich darin behaupten zu lernen.
Im Spiel mit der Puppe ist für das Kind ein permanenter spielerischer
Verwandlungsprozess möglich, der auf die Entwicklung von Potentialen
für mögliche Wirklichkeiten gerichtet ist. (vgl.
Fritz, S.69-72)

